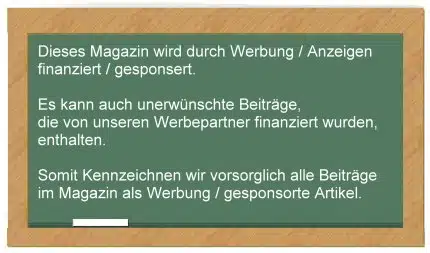Prof. Uwe Jun: Das liegt vor allem daran, dass wir derzeit deutlich unübersichtlichere Verhältnisse im Parteiensystem haben, als wir es in Deutschland gewohnt sind. In der Folge sind Bündnisse schwerer zu realisieren, beziehungsweise haben diese in der Vergangenheit dazu geführt, dass einzelne Partner vom Wähler abgestraft wurden. Konkret heißt dies, dass eine Vierer-Koalition naturgemäß schwerer zu bewerkstelligen ist, und dass die SPD derzeit nicht bereit zu sein scheint, erneut in eine große Koalition einzutreten, nachdem sie daraus zweimal mit schweren Verlusten hervorgegangen ist. Im Moment allerdings wächst der inner- und außerparteiliche Druck auf die SPD-Führung.
Ausgerechnet in einer Phase, in der die Demokratie durch Rechtspopulisten herausgefordert wird, bringen vier demokratische Parteien nicht genug Kompromissfähigkeit für eine Regierung auf. Müssen wir uns Sorgen machen?
Prof. Jun: Soweit würde ich nicht gehen. Aber Sie sprechen etwas Richtiges an: Der Kompromiss ist konstitutiv für das Funktionieren einer Demokratie, wesentlich für eine Koalitionsdemokratie wie unsere. Es erscheint mir allerdings deutlich verfrüht, die Demokratie in Gänze als gefährdet anzusehen, weil derzeit die Kompromissfähigkeit einzelner handelnder Politiker schwächer ausgeprägt zu sein scheint. Allerdings ist richtig, dass es einen Regierungsbildungsauftrag für die Parteien gibt und dass diese ihn auch wahrzunehmen haben. Wir kennen es auch aus anderen Ländern – in jüngster Zeit etwa aus den Niederlanden -, dass eine Regierungsbildung nicht unmittelbar klappen muss, ohne dass dieses gleich die Demokratie ins Wanken gebracht hätte. Dennoch sind die Parteien in Berlin jetzt gefordert, in absehbarer Zeit eine handlungsfähige Regierung zu bilden.
War die Zeit noch nicht reif für Jamaika, weil die FDP gerne noch länger in der Pose der außerparlamentarischen Opposition verharren wollte und die CSU von Machtkampf und bevorstehenden Wahlen gelähmt ist?
Prof. Jun: Das sind in der Tat zwei mögliche Gründe. Zudem fehlte es an einem gemeinsamen Projekt. Zudem gelang es den vier Parteien nicht, untereinander ausreichend Vertrauen herzustellen. Das aber ist nötig, um vier Jahre regieren zu können. Man hat sich auch während der Sondierungen aus meiner Sicht sehr ungewöhnlich verhalten, indem man ständig in den Medien versuchte, auf den anderen Druck auszuüben und Schuld zuzuweisen. Das war kontraproduktiv und hat den gesamten Sondierungsprozess behindert.
Wenn Sie im Schloss Bellevue sitzen würden, in welche Richtung würden Sie die Parteichefs drängen?
Prof. Jun: Zwischenzeitlich haben alle Parteien erklärt, dass sie Neuwahlen für eine realistische Option halten. Ich würde allerdings den Parteien mit auf den Weg geben, dass sie dann nach einem erneuten Urnengang im Frühjahr auch in der Pflicht stehen. Nun spiegelt das jüngste Wahlergebnis sehr gut wieder, wie fragmentiert die politische Willensbildung ist. Wäre da nicht das Experiment einer Minderheitsregierung die passende Antwort?
Prof. Jun: Das ist verfassungsrechtlich möglich. Man schafft sich aber neue Probleme. Eine Minderheitsregierung wäre instabil, in Extremfällen könnte sie gar sogar auf Zufallsmehrheiten angewiesen sein. Nicht übersehen darf man dabei auch, dass dieser Weg der AfD unter bestimmten Umständen eine wichtigere Rolle bescheren würde, nämlich in Einzelfällen möglicherweise die des Züngleins an der Waage. Bisher sind wir mit dem in der parlamentarischen Demokratie üblichen Gegeneinander von Regierungsmehrheit und Opposition gut gefahren. Die Stabilität unserer politischen Ordnung gründet nicht zuletzt darauf. Ohne verlässliche Mehrheit stünde die Möglichkeit einer Neuwahl ständig vor der Tür. Bisher haben wir funktionierende Minderheitsregierungen vor allem in Staaten, in denen eine homogene, auf Konsens beruhende politische Kultur prägend war, etwa in Skandinavien. Dort gilt es als unverantwortlich, das politische System in eine Krise zu stürzen, weshalb man immer wieder zu Einigungen kommt. Ähnliches war bei den Jamaika-Sondierungen jedenfalls in dieser Form nicht ersichtlich.
Wäre es nicht ein Armutszeugnis, erneut wählen zu lassen, weil den Politikern das Ergebnis nicht genehm ist?
Prof. Jun: In den Ländern Nordrhein-Westfalen, Hessen und Hamburg konnten in der Vergangenheit derartige Pattsituationen mit Neuwahlen aufgebrochen werden. Es muss nicht zwangsläufig zur Wiederholung eines ähnlich gelagerten Ergebnisses kommen. Der Wähler hat jetzt auch neue Informationen, nämlich dass FDP und SPD für bestimmte Konstellationen nicht zur Verfügung stehen, falls die SPD an ihrer Haltung festhält. Nun kann er bewerten, wie wichtig ihm die Herstellung einer stabilen Regierungsmehrheit ist. Falls die SPD ihre Meinung ändert, wären Neuwahlen ohnehin obsolet.
Staatspolitisches Verantwortungsbewusstsein ist quasi in der DNA der ältesten Partei, der SPD, verankert. Wie hoch wäre der Preis, um die Sozialdemokratie zu überzeugen?
Prof. Jun: Die SPD hat ein anderes, bedenkenswertes staatspolitisches Argument vorgebracht, nämlich, keine „österreichischen Verhältnisse“ in Deutschland haben zu wollen, also eine Dauer-GroKo, in der das Wechselspiel in der Regierungsverantwortung außer Kraft gesetzt ist. Stattdessen wollen die Sozialdemokraten wieder stärker den Wettbewerbsgedanken in den Vordergrund stellen. Man müsste etwas anbieten, was die Sorge der SPD vor schwindendem Ideenwettbewerb und schwindender Anhängerschaft entkräftet.
So etwas wie einen Rückzug Angela Merkels?
Prof. Jun: Nun, die SPD kann natürlich den Wettbewerber nicht dazu nötigen, ihr genehmes Personal aufzustellen.
Ausländische Kommentatoren läuteten bereits das Sterbeglöcklein für die Ära Merkel. Zu früh?
Prof. Jun: Frau Merkel hat selbst einmal angekündigt, nicht so lange regieren zu wollen wie Helmut Kohl. Wenn das stimmt, müsste spätestens in oder nach dieser Legislaturperiode Schluss sein. Aber noch ist sie als Kanzlerin keinesfalls Geschichte. Weder innerhalb noch außerhalb der CDU sehe ich außer ihr jemanden, der die Macht hätte sie abzulösen. Ist sie denn beschädigt, denkt man etwa an die Kritik der FDP an ihrer Verhandlungsführung? Prof. Jun: Ich bezweifle, dass nachgereichte Erklärungsmodelle, warum die Sondierungsgespräche scheiterten, sie nachhaltig beschädigen. Zumal Frau Merkel auch als Kanzlerin Entscheidungen nur in sehr seltenen Fällen einfach durchgedrückt hat, sondern eher moderierend wirkte. Diesem Stil, der sie immerhin drei Mal erfolgreich Koalitionsverhandlungen führen ließ, ist sie auch jetzt treu geblieben.
Würde die AfD, von denen viele Anhänger mit demokratischen Entscheidungsprozessen fremdeln, bei Neuwahlen profitieren?
Prof. Jun:Das wäre eine mögliche Folge, aber keine notwendige. Es kann auch sein, dass dem Wähler nun die Regierungsfähigkeit wichtiger wird. In den entsprechenden Neuwahlen in den Ländern war es so, dass die Regierungskräfte stärker wurden. Auch in Spanien war es nach monatelanger Hängepartie so, dass nicht die populistische Podemos profitierte, sondern die regierende Volkspartei.
Spiegelt die sichtbar gewordene Kompromissunfähigkeit der Parteien einen entsprechenden Trend in der Gesellschaft wider? Immer weniger Menschen etwa sind bereit, Kompromisse einzugehen, um sich in einer Volkspartei zu engagieren. Lieber engagieren sie sich in Bürgerinitiativen, um Partikularinteressen durchzusetzen.
Prof. Jun: In der Tat. Sie sprechen da einen besorgniserregenden Trend an. Kompromisse werden oft mit einem negativen Beigeschmack versehen, geradezu denunziert. Oft geht das damit einher, dass die eigene Meinung höher gewertet wird als die anderer. Wir haben aber eine Vielfalt an Meinungen, Werten und Interessen. Daraus müssen Kompromisse geschmiedet werden. Immer öfter wird nun versucht, die eigene Meinung über die anderer anzusiedeln. Das ist einer Demokratie, die abhängig ist im Austarieren von Interessen, nicht dienlich. Wir müssen aufpassen, dass uns die Fähigkeit zum Kompromiss nicht verloren geht. Schon einmal ist eine deutsche Demokratie unter anderem auch an gering ausgeprägter Kompromissfähigkeit gescheitert.
Das Interview führte Joachim Zießler
Original-Content von: Landeszeitung Lüneburg, übermittelt durch news aktuell