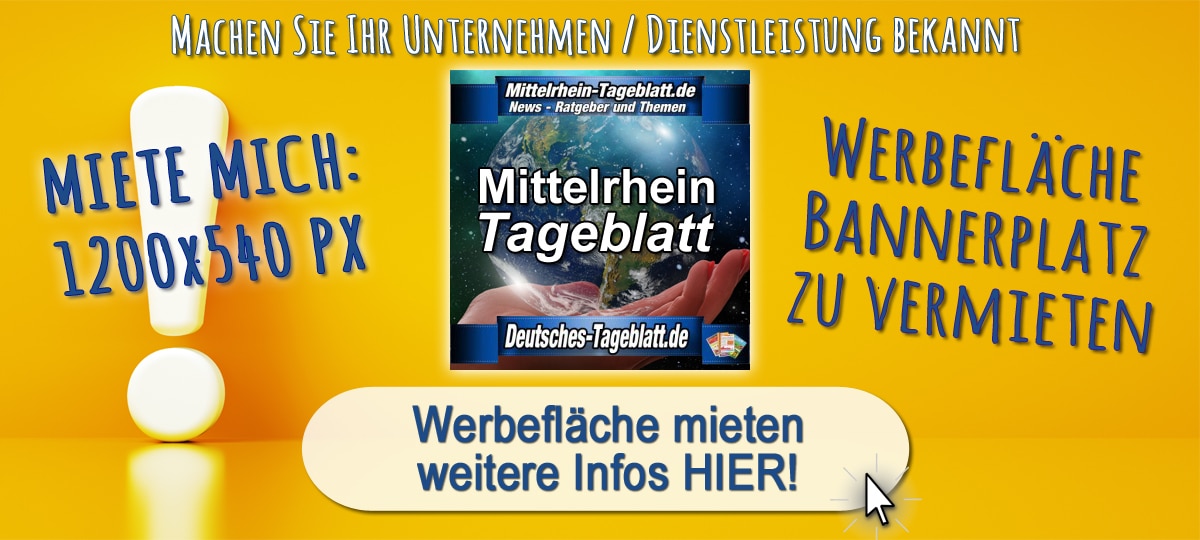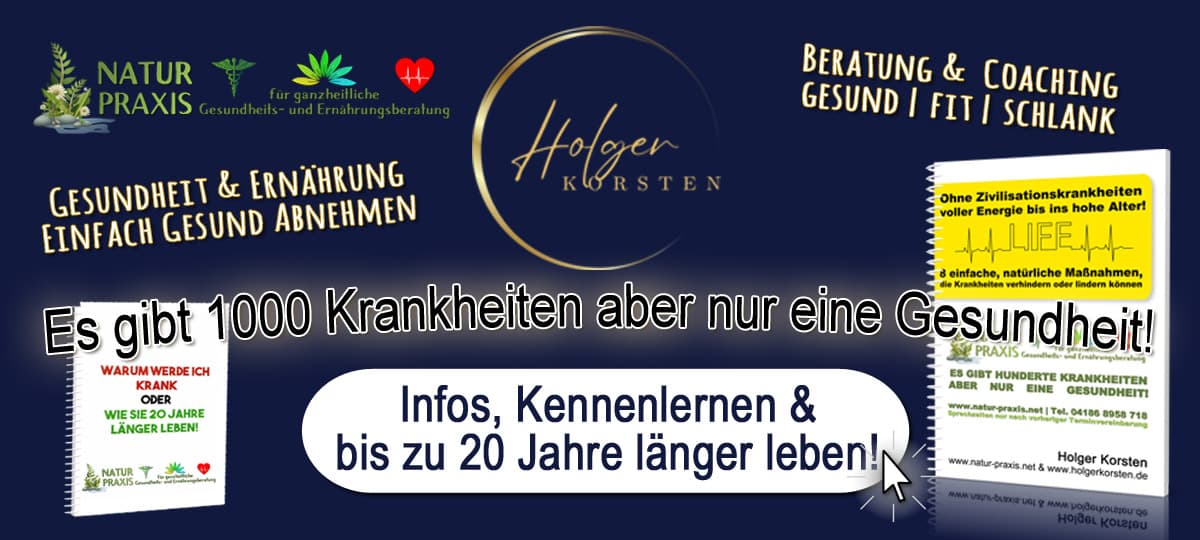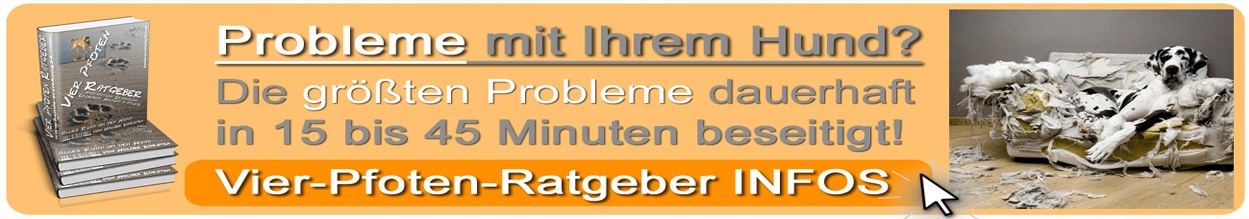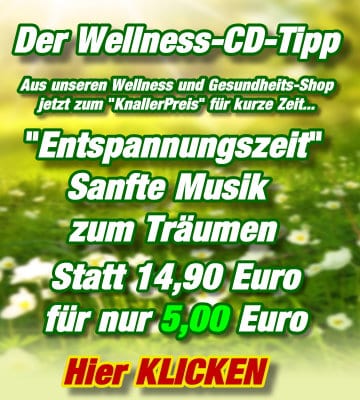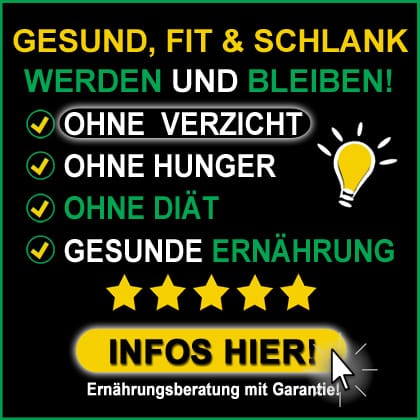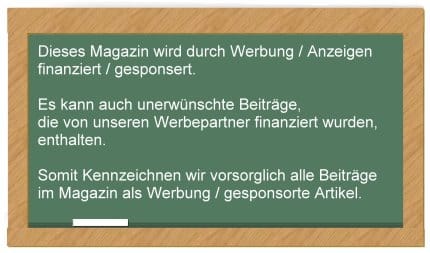Kohlekraftwerk Ibbenbüren gesprengt – Fortschritt oder energiepolitischer Fehler?
Ibbenbüren (NRW) – Am Samstag, dem 6. April 2025, fiel in Ibbenbüren ein Stück Industriegeschichte in sich zusammen. In einer spektakulären Aktion wurde das ehemalige Steinkohlekraftwerk der RWE gesprengt – ein massiver Eingriff mit Symbolcharakter. Während das Kesselhaus und der 125 Meter hohe Kühlturm binnen Sekunden in Trümmer fielen, entbrannte eine bundesweite Debatte um die Sinnhaftigkeit der deutschen Energiepolitik. Handelt es sich um ein mutiges Signal für die Energiewende oder um einen gefährlichen energiepolitischen Irrweg?
Ein Kraftwerk fällt – und mit ihm ein Kapitel Energiegeschichte
Das 1985 in Betrieb genommene Kraftwerk Ibbenbüren war über Jahrzehnte fester Bestandteil der Stromversorgung in Nordrhein-Westfalen. Es wurde mit Steinkohle aus der benachbarten Zeche betrieben und galt bis zur Stilllegung im Jahr 2021 als verlässliche Quelle grundlastfähiger Energie. Die Sprengung markierte nun endgültig das Ende dieses Kapitels – und machte Platz für eine neue Zukunftsvision: eine moderne Konverterstation für Windenergie.
Etwa 130 Anwohnerinnen und Anwohner sowie rund 700 Menschen aus einer nahegelegenen Flüchtlingsunterkunft wurden vorsorglich evakuiert. Tausende verfolgten das Ereignis live – viele mit Wehmut, andere mit Hoffnung auf eine klimafreundlichere Energieversorgung.
Ein Milliardenprojekt für Windstrom – und viele offene Fragen
Auf dem Gelände soll in den kommenden Jahren eine sogenannte Konverterstation entstehen, mit deren Hilfe Windstrom aus der Nordsee in das deutsche Stromnetz eingespeist werden kann. Das Projekt „BalWin 2“, das vom Übertragungsnetzbetreiber Amprion koordiniert wird, ist Teil eines groß angelegten Offshore-Netzausbaus. Die geplanten Investitionen belaufen sich auf etwa 600 Millionen Euro allein für die Station in Ibbenbüren, das Gesamtprojekt umfasst rund vier Milliarden Euro. Die Inbetriebnahme ist für 2031 vorgesehen.
Kritiker fragen sich, ob sich diese hohen Summen rechnen – oder ob hier eine grüne Vision auf Kosten der Steuerzahler verwirklicht wird. Denn: Noch immer ist die Einspeisung von Windstrom wetterabhängig und ohne entsprechende Speicherlösungen schwer planbar. Gleichzeitig steigt der Strombedarf durch Elektromobilität, Digitalisierung und Wärmepumpen kontinuierlich an.
Politischer Zündstoff – Kritik von der AfD und konservativen Kreisen
Vor allem aus den Reihen der AfD kam massive Kritik. In einem Statement auf X (ehemals Twitter) nannte die Partei die Sprengung ein „Bild des Irrsinns“ und sprach von „ideologischer Selbstzerstörung“. Die Partei fordert einen sofortigen Stopp des Rückbaus von Kohle- und Kernkraftwerken sowie einen „realistischen Energiemix“ aus bewährten Quellen. Die Konverterstation sei Symbol einer Energiepolitik, die Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit gefährde.
Auch Stimmen aus der Industrie teilen diese Sorgen. Energieintensive Betriebe beklagen steigende Preise und warnen vor Standortnachteilen. Die Frage nach Versorgungssicherheit wird lauter – insbesondere in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und globaler Konkurrenz.
Befürworter: Ein notwendiger Schritt in die Zukunft
Auf der anderen Seite steht ein breites Bündnis aus Umweltverbänden, Teilen der Politik und Bürgern, die die Sprengung als notwendiges Signal werten. Für sie ist der Rückbau fossiler Infrastruktur ein konsequenter Schritt hin zu einer klimaneutralen Energieversorgung. NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) bezeichnete die neue Konverterstation als „Brücke zwischen Nordsee-Wind und westdeutscher Industrie“. Deutschland müsse, so Neubaur, führend in der nachhaltigen Energieversorgung werden, um Wohlstand und Klimaschutz zu verbinden.
Auch die EU-Kommission unterstützt den Ausbau erneuerbarer Energien mit milliardenschweren Programmen. Deutschland nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein – mit allen Chancen, aber auch mit Risiken.
Und der Rest der Welt? Ein differenziertes Bild
Ein Blick über die Landesgrenzen hinaus zeigt: Die Welt geht in Sachen Energie ganz unterschiedliche Wege. Während Deutschland Kohlekraftwerke zurückbaut und die Kernkraft komplett aufgegeben hat, setzen andere Länder weiterhin gezielt auf diese Energieformen.
Kohle feiert in Asien ein Comeback:
China baut derzeit neue Kohlekraftwerke mit einer Kapazität von über 90 Gigawatt – so viel wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Indien verfolgt ähnliche Pläne. Auch Länder wie Indonesien, Bangladesch und Südafrika setzen weiterhin stark auf Kohle, um ihre wachsende Bevölkerung mit Strom zu versorgen. Im Gegensatz dazu haben europäische Staaten wie das Vereinigte Königreich (Abschaltung der letzten Kohlemeiler 2024) und Frankreich (Kohleausstieg bis 2022 geplant) den Rückbau weitgehend abgeschlossen oder beschlossen.
Atomkraft erlebt eine Renaissance:
Weltweit sind derzeit 59 neue Atomreaktoren im Bau. China führt mit 25 Einheiten, Indien folgt mit sieben. Sogar Länder wie Bangladesch, Ägypten oder die Türkei bauen erstmals überhaupt Kernkraftwerke. In Europa wurde auf dem ersten Nuclear Energy Summit im März 2024 von 32 Ländern – darunter 14 EU-Staaten – die Absicht erklärt, das volle Potenzial der Kernkraft zur Erreichung der Klimaziele auszuschöpfen. Deutschland bleibt auch hier außen vor.
Erneuerbare Energien weltweit auf dem Vormarsch – aber noch nicht dominant:
Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet, dass der Anteil erneuerbarer Energien am globalen Endenergieverbrauch bis 2030 auf etwa 20 % steigt (2023: 13 %). Dennoch dominieren fossile Brennstoffe weiterhin den globalen Energiemix. 2023 stammten etwa 60 % der weltweiten Stromerzeugung aus Kohle, Öl und Gas – ein Anteil, der insbesondere durch das Wachstum in Asien stabil bleibt.
Fazit: Zwischen Ideal und Realität
Die Sprengung des Kraftwerks in Ibbenbüren ist weit mehr als ein technischer Rückbau – sie ist Symbol einer tiefgreifenden Transformation. Deutschland geht einen energischen Sonderweg, der mutig, aber auch riskant ist. Während der Rest der Welt auf eine Mischung aus alten und neuen Technologien setzt, legt Deutschland fast alles auf die Karte der Erneuerbaren – ohne eigene Kernenergie und bald auch ohne Kohle.
Ob diese Strategie langfristig erfolgreich sein wird, bleibt offen. Klar ist: Die Herausforderungen der Energiewende erfordern nicht nur politische Entschlossenheit, sondern auch technologische Innovation, wirtschaftliche Tragfähigkeit und internationalen Realismus (hk).