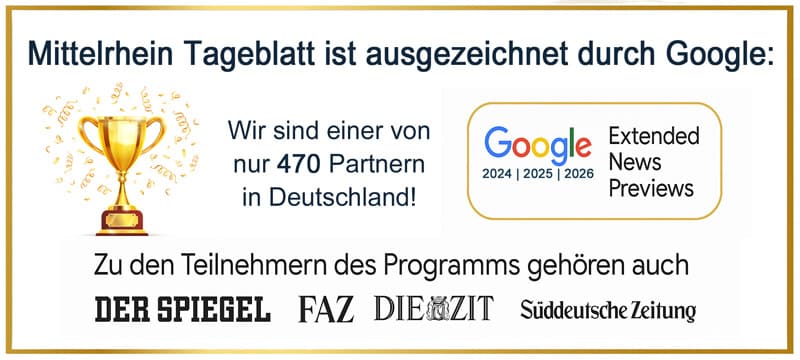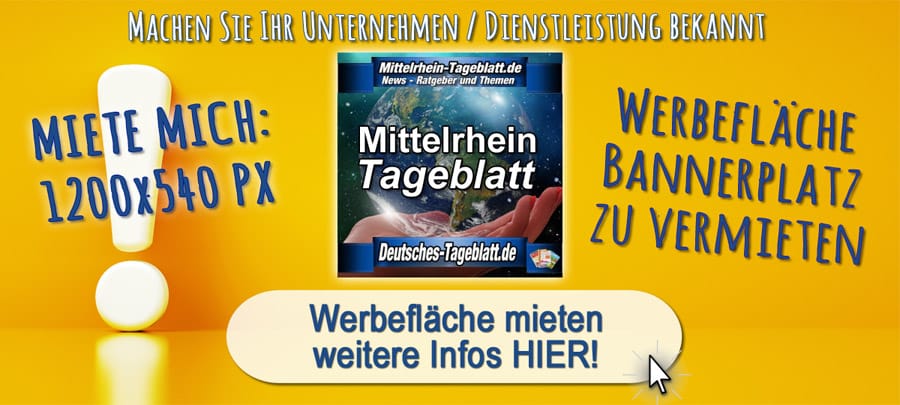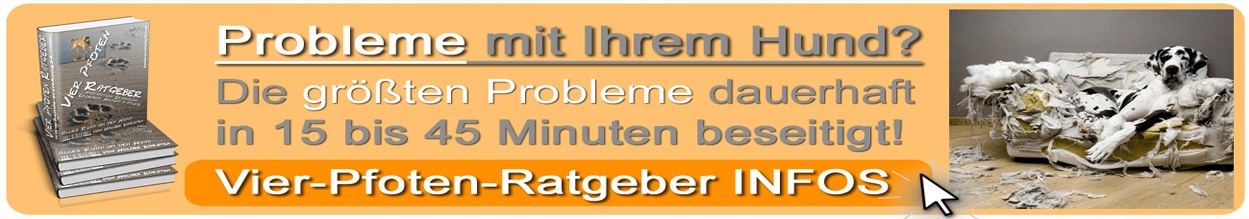Sprengung Atomkraftwerk Gundremmingen – Kritik an Energiepolitik wächst – Heute Mittag, Punkt 12 Uhr, soll in Gundremmingen ein Stück deutscher Energiegeschichte in einer gigantischen Staubwolke verschwinden: Die beiden 160 Meter hohen Kühltürme des ehemaligen Atomkraftwerks werden gesprengt. Was für die einen ein symbolträchtiger Moment der Energiewende ist, empfinden andere als ein Sinnbild politischen Irrsinns – denn während ein zuvor sicheres und leistungsstarkes Kraftwerk dem Erdboden gleichgemacht wird, plant Deutschland gleichzeitig den Bau neuer Gaskraftwerke, um die Grundlast zu sichern.
Hier gibt es das Live Bild zur Sprengung des Atomkraftwerks Gundremmingen:

Ein Kapitel deutscher Industriegeschichte endet im Staub
Das Kernkraftwerk Gundremmingen, einst das leistungsstärkste Deutschlands, versorgte über Jahrzehnte Millionen Haushalte zuverlässig mit Strom. Rund 20 Milliarden Kilowattstunden jährlich lieferte die Anlage – und das mit einem hohen Sicherheitsstandard, wie selbst Kritiker der Atomkraft einräumen. Nun sollen etwa 56.000 Tonnen Stahlbeton in wenigen Sekunden fallen – ein letzter, symbolischer Akt des deutschen Atomausstiegs.
Doch diese Sprengung ist weit mehr als nur ein technisches Ereignis. Sie steht für eine politische Haltung, die seit Jahren polarisiert. Denn während die Reste des Reaktors abgetragen werden, wächst in der Bevölkerung und bei Fachleuten die Sorge: Wird Deutschland durch diese Entscheidungen in eine neue Energieabhängigkeit geführt?
Gaskraftwerke als Ersatz – eine teure Rückkehr in die Fossilwelt
Parallel zur Sprengung werden bundesweit Pläne für neue Gaskraftwerke vorangetrieben. Sie sollen als flexible Reserve dienen, wenn Wind und Sonne nicht genug Strom liefern. Kritiker bezeichnen dies jedoch als energiepolitisches Paradox: Statt die klimaneutrale und grundlastfähige Kernenergie zu nutzen, setzt man wieder auf fossile Brennstoffe – und das mitten in einer Zeit, in der Klimaneutralität oberstes Ziel sein sollte.
Auch wirtschaftlich ist die Strategie fragwürdig. Der Rückbau der Atomkraftwerke kostet Milliarden, während gleichzeitig Milliarden in neue fossile Kraftwerke investiert werden. Für viele Experten ein Schritt zurück: Während man eine Technologie vernichtet, die über Jahrzehnte verlässlich Strom lieferte, schafft man neue Abhängigkeiten von Erdgas – oftmals importiert aus politisch instabilen Regionen.
Energiepolitisches Paradox: Ideologie vor Vernunft?
Befürworter der Energiewende verweisen auf Sicherheitsrisiken und ungelöste Endlagerfragen. Doch die Realität zeigt: Andere Länder wie Frankreich, Finnland oder Japan setzen weiterhin auf moderne Reaktortechnologien, kombinieren sie mit Erneuerbaren und sichern damit ihre Grundversorgung. Deutschland hingegen geht einen Sonderweg – einen, der zunehmend hinterfragt wird.
Während die Kühltürme in Gundremmingen fallen, stehen neue Gaskraftwerke in den Startlöchern. Die Bundesregierung spricht von einem „Brückentechnologie“-Modell. Doch viele Beobachter fragen sich: Wohin führt diese Brücke – in eine nachhaltige Zukunft oder in ein energiepolitisches Chaos, das auf Kosten von Wirtschaft, Klima und Verbrauchern geht?
Symbolik und Realität
Die Sprengung in Gundremmingen wird als Triumph der Energiewende gefeiert – doch sie könnte sich als Symbol des energiepolitischen Scheiterns erweisen. Denn in einer Zeit, in der Energiepreise steigen, Netze unter Druck stehen und Speichertechnologien noch nicht ausgereift sind, sendet Deutschland ein widersprüchliches Signal an die Welt:
Man zerstört, was funktioniert – und baut auf, was wieder CO₂ ausstößt.
Vielleicht steht die Staubwolke, die heute über Gundremmingen aufsteigt, nicht nur für das Ende eines Kraftwerks, sondern für das langsame Verblassen einer einst verlässlichen Energiepolitik.
Update 12:01 – Die Sprengungen der beiden Kühltürme verliefen erfolgreich
Die beiden 160 Meter hohen Kühltürme des ehemaligen Atomkraftwerks Gundremmingen in Bayern sind am Samstagmittag, den 25. Oktober 2025, pünktlich und planmäßig gesprengt worden. Der kontrollierte Einsturz verlief reibungslos – die Türme stürzten in sich zusammen und hinterließen eine riesige Staubwolke, die über dem Gelände aufstieg.
Nach Angaben des Betreibers handelte es sich bei der Sprengung um einen zentralen Schritt im Rückbauprozess der Anlage. Insgesamt sind rund 56.000 Tonnen Stahlbeton zu Boden gegangen, die in den kommenden Monaten abgetragen, entsorgt und weitgehend recycelt werden sollen.
Das Kernkraftwerk Gundremmingen, einst das leistungsstärkste in Deutschland, war über Jahrzehnte ein bedeutender Bestandteil der bayerischen Energieversorgung. Es lieferte jährlich rund 20 Milliarden Kilowattstunden Strom und wurde 2021 endgültig vom Netz genommen.
Mit der heutigen Sprengung endet ein sichtbares Kapitel deutscher Atomgeschichte – der Rückbau des Standorts wird jedoch noch mehrere Jahre dauern. (hk)
Quellen: Augsburger Allgemeine, Welt, B4B Schwaben, Schwaebische Post, RWE, Wikipedia, Bundesumweltministerium.